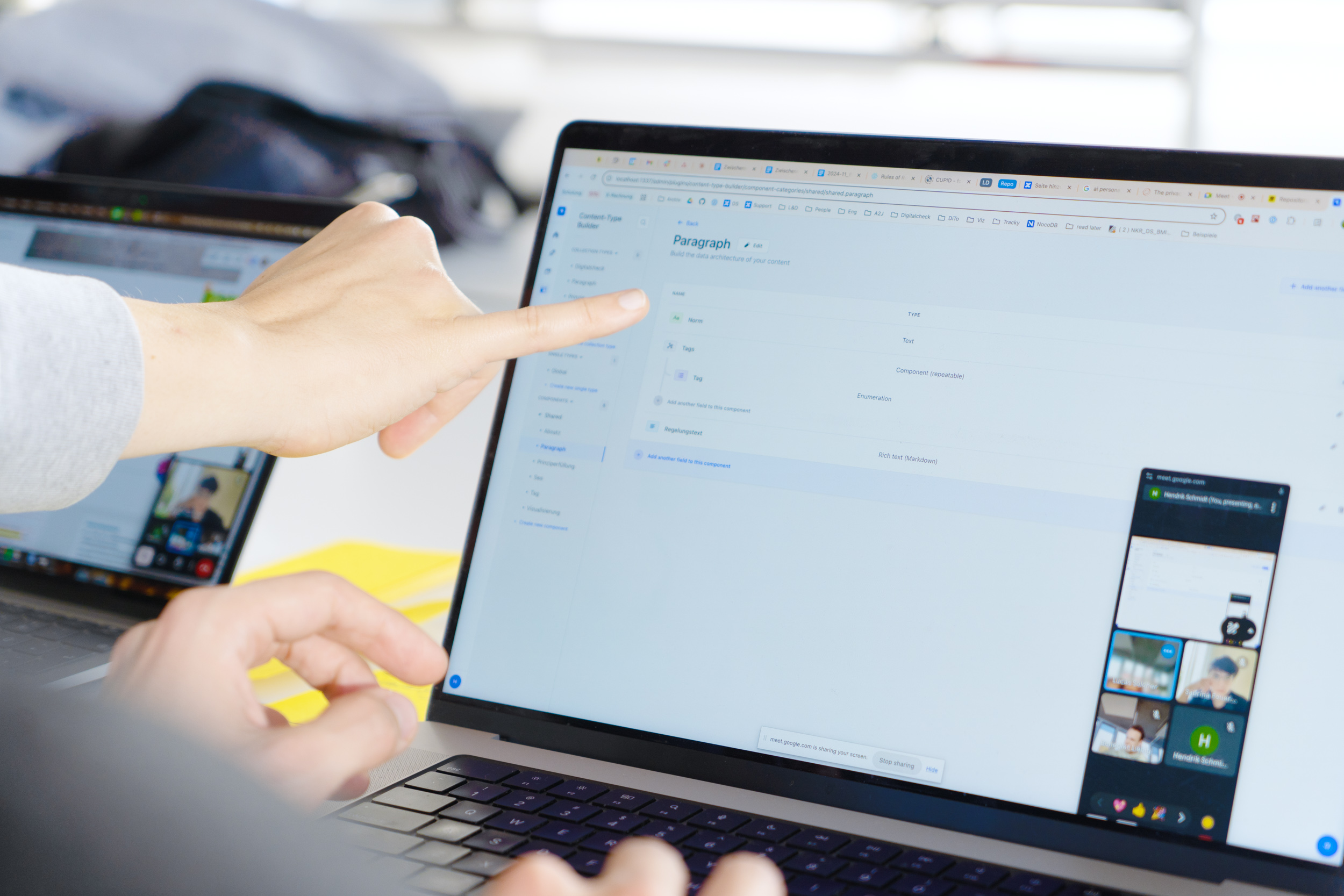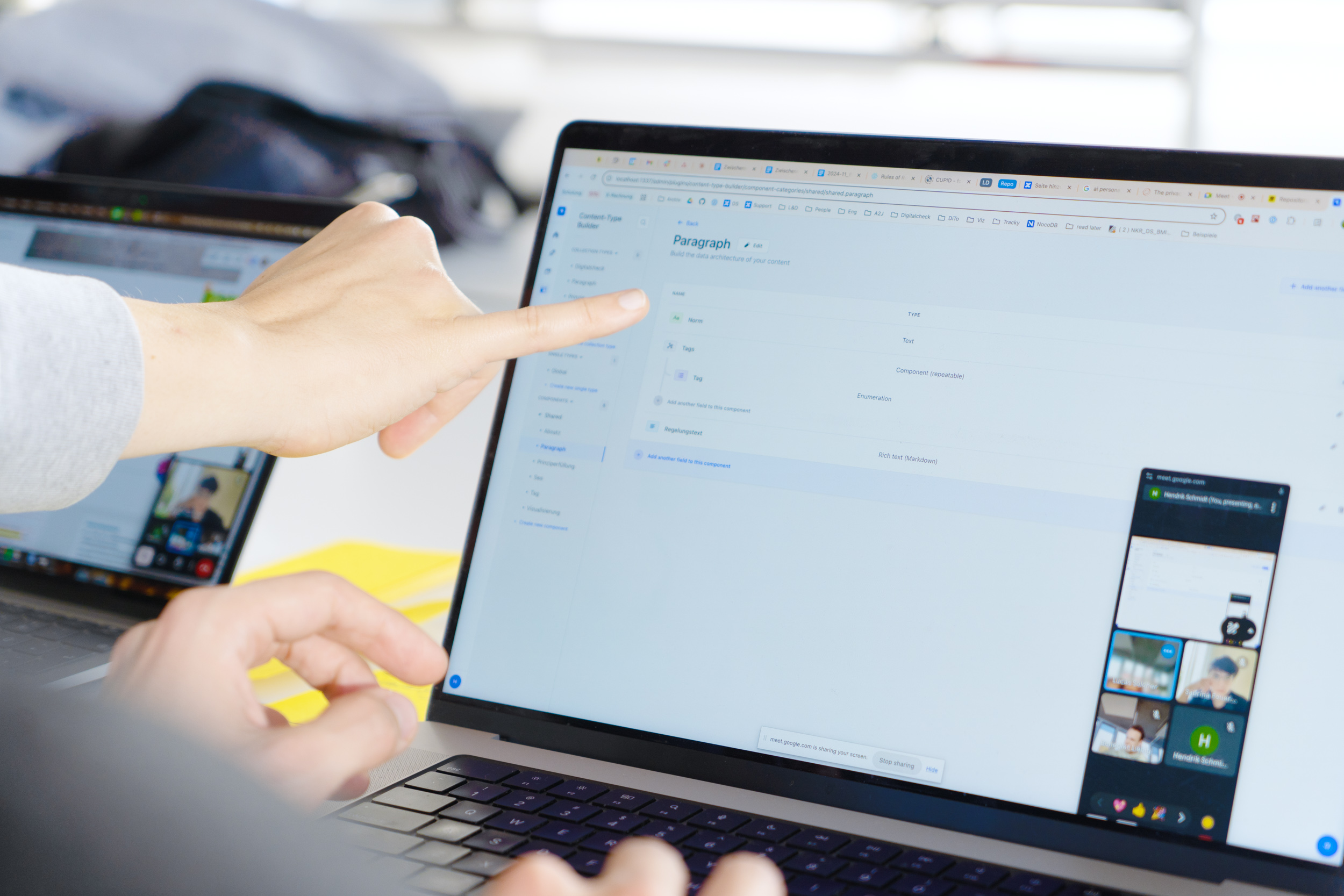

Digital- und praxistaugliche Gesetzgebung: Was in der nächsten Legislaturperiode wichtig wird
Noch nie war der Ruf nach einer umfassenden Modernisierung des Staates so laut wie heute. Vorschläge, wie von der „Initiative für einen handlungsfähigen Staat“, vom Normenkontrollrat, der Agora Digitale Transformation oder der „Allianz für den Staat von Morgen“ nennen dabei auch die Gesetzgebung als zentrales Handlungsfeld.
In der letzten Legislatur hatte sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, einen Digitalcheck für Gesetze einzuführen und in diesem Zusammenhang den Normenkontrollrat mit einem erweiterten Prüfmandat ausgestattet. Seit 2022 entwickelt der DigitalService im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und im kontinuierlichen Austausch mit dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) die Maßnahmen für eine digitaltaugliche Gesetzgebung. Dabei haben wir bereits wichtige Erfolge erzielt: In über 90 % der neuen Bundesgesetze werden mittlerweile Elemente des Digitalcheck genutzt. Wir haben über 70 Regelungen in unterschiedlicher Intensität beraten und in 2024 innerhalb von nur zwei Monaten 220 Verwaltungsmitarbeitende geschult.
Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen wissen wir, welche nächsten Schritte die kommende Bundesregierung auf dem Weg zu einer wirkungsorientierten, digital- und praxistauglichen Gesetzgebung entscheidend bei der Digitalisierung voranbringen können. Denn: Die Voraussetzungen für eine praxisnahe Umsetzung werden bereits in der Rechtsetzung gelegt. Das heißt, gute und wirksame Gesetze bilden die Ausgangsbasis, den Alltag von Bürger:innen, Unternehmen und Verwaltungsmitarbeitenden spürbar zu erleichtern, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten durch gezielte Entbürokratisierung zu senken. Um das zu erreichen, braucht es neben der Weiterentwicklung und flächendeckenden Bereitstellung von Unterstützungsmaßnahmen für Rechtsetzungsreferate im Bereich digital- und praxistaugliche Gesetzgebung auch ressortübergreifende, strukturelle Veränderungen. Sichtbar wird das in den Erkenntnissen, die wir im Rahmen einer Evaluierung gesammelt haben.
Der Digitalcheck wird seit 2022 aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. Die Angebote im Rahmen des Digitalcheck unterstützen Bundesministerien dabei, rechtliche Regelungen von Anfang an digitaltauglich und praxisnah zu gestalten – durch interdisziplinäre Expertise und methodische Hilfestellung. Dabei ist „der Digitalcheck“ keine einfache Checkliste, sondern eine methodische Prozessbegleitung für Rechtsetzungsreferate. Zu den Angeboten gehören interdisziplinäre Expertise, Schulungen und (digitale) Werkzeuge zur Unterstützung. Die Vision: Jede rechtliche Regelung trägt zu einem digitalen und leistungsfähigen Staat bei – durch effiziente Umsetzung, schlanke Verfahren, geringere Kosten und bessere Nutzungserlebnisse.
Evaluierung liefert drei zentrale Erkenntnisse
In den ersten zwei Jahren nach der Einführung des Digitalcheck durch die Bundesregierung haben wir gezielt Maßnahmen zur Stärkung einer digital- und praxistauglichen Gesetzgebung entwickelt. Dazu gehören unter anderem eine Support-Hotline für schnelle Rückfragen zur digitalen Umsetzbarkeit, Beratung zu technischen Fragestellungen sowie Schulungen zur Erstellung von Prozessvisualisierungen.
Um die Wirksamkeit der Digitalcheck Maßnahmen zu bewerten, haben wir im Jahr 2024 eine qualitative und quantitative Analyse durchgeführt. Ziel war es, den Einfluss der Maßnahmen auf Verwaltungsmitarbeitende zu untersuchen: Inwiefern helfen sie bei der Erarbeitung digitaltauglicher Regelungen im Alltag? Was sind Hemmnisse für deren Nutzung? Wie ist die prozessuale Verankerung der Digitalcheck Instrumente? Welche weiteren Unterstützungsangebote werden gewünscht?
Qualitativ
Zielsetzung
- Tiefe Erkenntnisse zur Anwendung und Wirksamkeit der Methoden sowie Identifikation von Good Practices
Ablauf
-
21 qualitative explorative Interviews
-
Befragte: Legist:innen, umsetzende Behörden, Mitglieder des NKR
-
Zeitraum: 07/24 – 09/24
Quantitativ
Zielsetzung
- Evaluation der Wirkung der unterschiedlichen Digitalcheck Instrumente, um Bedarfe und ungenutzte Potenziale aufzuzeigen
Ablauf
-
131 ausgefüllte Online-Fragebögen
-
Befragte: Verwaltungsmitarbeitende, die die Digitalcheck Dokumentationen abgeben, an Schulungen oder Unterstützungsangeboten teilgenommen haben.
-
Zuzüglich drei qualitative Interviews (Nachbefragung der Regelungsbegleitung)
-
Zeitraum: 10/24 – 11/24
Dafür haben wir zunächst 22 leitfadengestützte Interviews mit Verwaltungsmitarbeitenden, Vertreter:innen umsetzender Behörden und Mitarbeitenden des NKR-Sekretariats geführt. Die Gespräche dauerten jeweils etwa 60 Minuten. Ergänzend dazu fanden im Oktober und November 2024 quantitative Online-Befragungen mit insgesamt 131 Teilnehmenden statt.
Die Evaluierung hat drei zentrale Erkenntnisse hervorgebracht:
- Die persönliche Unterstützung durch interdisziplinäre Expertise ist besonders hilfreich. Der objektive Blick von Digitalexpert:innen trägt entscheidend dazu bei, praxisnahe und digital gut umsetzbare Regelungen zu entwickeln.
- Visualisierungen, der Einbezug von Umsetzungsakteuren und die fünf Prinzipien für digitaltaugliches Recht tragen maßgeblich zur Digitaltauglichkeit der Regelungen bei. Die Evaluierung aber zeigt: Damit diese Methoden wirksam eingesetzt werden, braucht es geeignete Vermittlungsangebote (z. B. Schulungen) und praxisnahe Beispiele – beides ist stark nachgefragt.
- Die Methoden des Digitalcheck sollten von Beginn an den Erarbeitungsprozess begleiten. Dies ist derzeit noch nicht der Fall. Aktuell wird der Digitalcheck von der Mehrheit der Befragten als abschließende Checkliste genutzt, was seine Wirksamkeit erheblich einschränkt.
Erkenntnis 1: Die persönliche Unterstützung durch interdisziplinäre Expert:innen wird als besonders wertvoll erachtet
Als ersten Schritt in der Entwicklung des Digitalcheck haben wir 2022 gemeinsam mit dem BMI und einer interministeriellen Arbeitsgruppe fünf Prinzipien für digitaltaugliche Regelungen entwickelt. Schnell wurde klar: Damit die Prinzipien im Regelungstext umgesetzt werden, braucht es Unterstützungsangebote für Rechtsetzungsreferate. Seitdem haben wir sukzessive das Unterstützungsangebot in Form von persönlicher Beratung und Begleitung aufgebaut und erweitert.
Die Intensität der Unterstützung ist flexibel gestaltet: Sie reicht von schneller Hilfe über eine kostenfreie Support-Hotline und der gemeinsamen Entwicklung von Visualisierungen (z. B. Vollzugsprozesse oder Regelungsbäume) bis hin zu einer mehrwöchigen Begleitung im Erarbeitungsprozess, einschließlich niedrigschwelliger Beteiligungsformate. Alle Unterstützungsangebote werden auf der Digitalcheck Webseite gesammelt aufgeführt.
Verwaltungsmitarbeiter:innen, die die Angebote nutzen, empfinden besonders die persönliche Unterstützung durch interdisziplinäre Expert:innen (z. B. Service-Design, Software-Entwicklung, Data Science oder Prozess-/Produktmanagement) als besonders wertvoll. Mit einer Zufriedenheitsbewertung von 4,7 auf einer Skala von 1 bis 5 und einer ebenso hohen Einstufung hinsichtlich ihrer Alltagstauglichkeit zeigt sich die hohe Relevanz der Maßnahmen. Zudem bestätigt eine Weiterempfehlungsquote von 10 (Skala 1 bis 10) die breite Akzeptanz und Anerkennung. Ein zentraler Faktor ist der fachübergreifende Blick: Die Verwaltungsmitarbeiter:innen geben an, die externe Digital- und Tech-Expertise als besonders wertvoll zu empfinden. 79 % der Befragten sehen zusätzliche IT- und Digitalexpertise als entscheidend, um digitaltaugliche Regelungen effektiver zu entwickeln. Eine Herausforderung ist jedoch: Viele Angebote sind noch nicht ausreichend bekannt in den Häusern und werden in der Fläche noch nicht abgefragt.
Erkenntnis 2: Es besteht eine klare Nachfrage nach Vermittlungsangeboten und praxisnahen Beispielen
Die Methoden des Digitalcheck stärken die Digitaltauglichkeit der Regelungen. Weiter informiert dazu der Blogbeitrag „Wie praxisnahe und digital umsetzbare Gesetze entstehen“.
Legist:in
Visualisierungen helfen, Dinge durchzuspielen: Wie kann ich Sachen einfacher machen? Kästchen hin und her schieben, Vorher-Nachher-Darstellung. Es ist gut, rumzuspielen und kreativer zu sein!
So sind Visualisierungen ein wertvolles Instrument, um Digitalisierungspotenziale sichtbar zu machen, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen und den Austausch mit Umsetzungsbehörden zu erleichtern. Diese Vorteile werden von Verwaltungsmitarbeitenden, umsetzenden Behörden und Führungskräften anerkannt. Dennoch ist die Arbeit mit Visualisierung noch lange nicht der Normalfall in der Erarbeitung von Regelungen.
Damit Visualisierungen fester Bestandteil von Erarbeitungsprozessen für Regelungen werden, müssen geeignete Tools und Templates bereitgestellt werden. Und um deren Nutzung in der Verwaltung zu erleichtern und mögliche Hemmschwellen abzubauen, sind gezielte Vermittlungsangebote und praxisnahe Beispiele erforderlich. Beispiele für in Gesetzgebungsprozessen erarbeitete Visualisierungen stellen wir mittlerweile zur Orientierung auf unserer Webseite erarbeiten.digitalcheck.bund.de bereit.
Der Schulungsbedarf ist weiterhin hoch: 65 % der befragten Verwaltungsmitarbeitenden wünschen sich gezielte Trainings zur Erstellung von Visualisierungen. Die Nachfrage nach Schulungen wurde auch im vergangenen Jahr sichtbar, als das Digitalcheck Team Schulungen zum Thema Visualisierungen und Prinzipien für digitaltaugliches Recht anbot. In kürzester Zeit meldeten sich 220 Mitarbeiter:innen für die freiwilligen Online-Formate an. 65 % empfanden die Schulungen als sehr hilfreich oder hilfreich. 85 % der Teilnehmenden würden die Schulungen weiterempfehlen.
Erkenntnis 3: Methoden werden häufig zu spät angewendet, wodurch ihr volles Potenzial nicht ausgeschöpft wird
Die Methoden des Digitalcheck sind besonders wirkungsvoll, wenn sie bereits in der frühen konzeptionellen Phase des Erarbeitungsprozesses eingesetzt werden – also bevor ein Regelungstext verfasst wird. Dazu informiert der Blogbeitrag „Wie praxisnahe und digital umsetzbare Gesetze entstehen“.
Legist:in
Es [der Digitalcheck] hat geholfen, das Gesetz noch digitaltauglicher auszugestalten und Sachen in die Begründungen mit aufzunehmen, an die ich ohne den Digitalcheck nicht gedacht hätte.
Unsere Evaluierung zeigt jedoch, dass 95 % der Befragten die Digitalcheck Dokumentation erst nach Abschluss des Entwurfs bearbeiten. Damit wird der Digitalcheck vor allem als Kontrollinstrument, nicht aber als gestaltendes Werkzeug wahrgenommen.
Die wahrgenommene Verankerung des Digitalcheck als Dokumentation am Ende und die Unkenntnis über die weiteren Unterstützungsangebote schränkt dessen Wirksamkeit ein. Die größten Hürden für eine frühzeitige Nutzung sind: fehlende Beispiele und Templates (46 %), mangelnde Integration in bestehende Prozesse (40 %), unzureichendes Verständnis der fünf Prinzipien (35 %) sowie eine späte Bekanntmachung des Digitalcheck (32 %).
Um dem Wunsch nach praxisnahen Beispielen nachzukommen, haben wir bereits eine Lösung geschaffen: Auf beispiele.digitalcheck.bund.de finden Verwaltungsmitarbeitende Gesetzestexte, die die Prinzipien digitaltauglicher Gesetzgebung erfolgreich umsetzen. Diese Sammlung bietet Orientierung und Inspiration für die Entwicklung zukunftsfähiger Regelungen und wird fortlaufend erweitert.
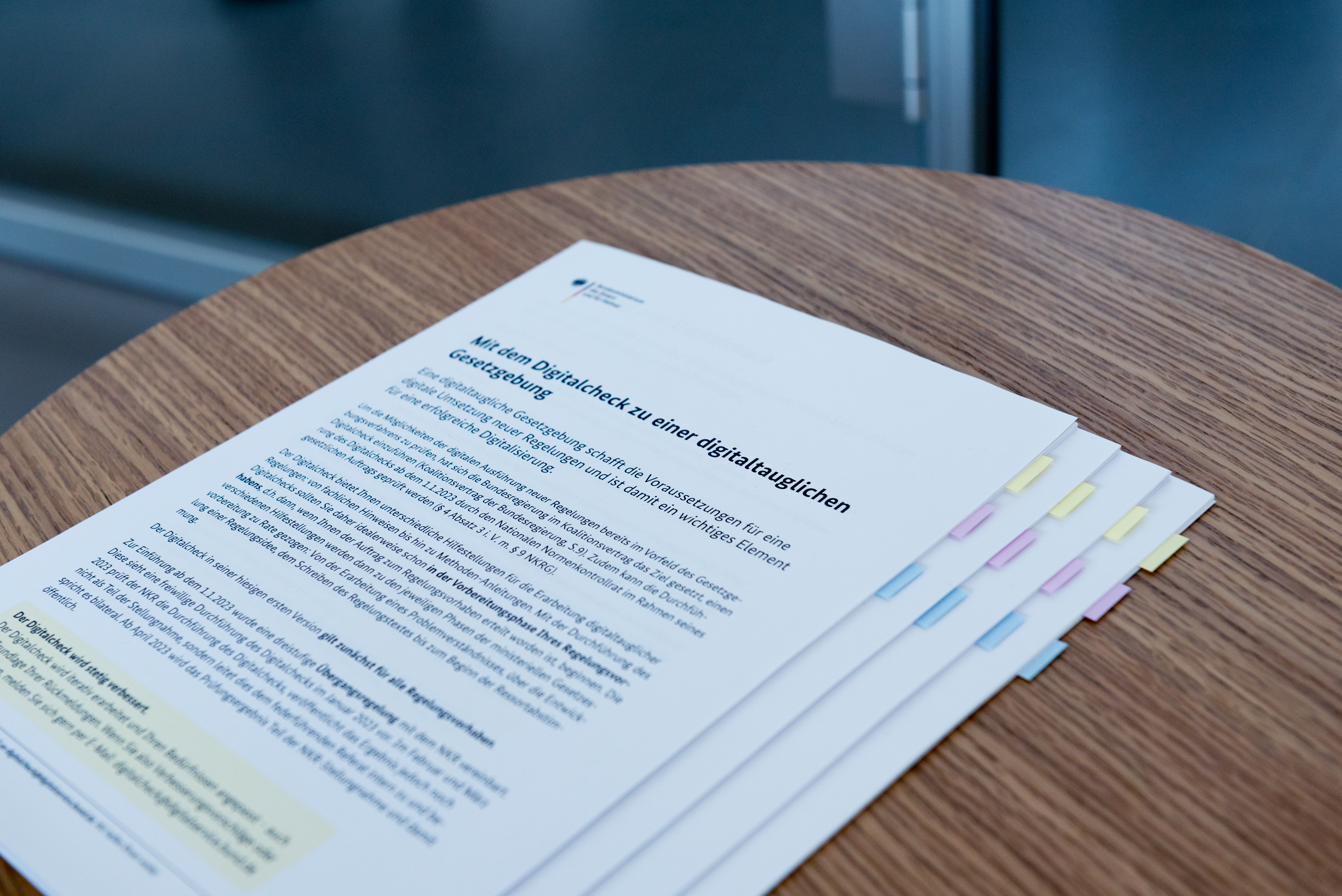
Was wir darüber hinaus gelernt haben
Durch unsere intensive Arbeit an der digitalen Gesetzgebung haben wir weitere Initiativen zur besseren Rechtsetzung kontinuierlich analysiert und teilweise eng begleitet. Darunter den Praxischeck, den Bürgercheck und das Zentrum für Legistik. Diese Ansätze sind wertvoll, doch ihre unabhängige Existenz führt in der Praxis bei den Verwaltungsmitarbeitenden oft zu Verwirrung und begrenzt so ihre Wirksamkeit.
Hinzu kommt, dass die Instrumente wie der Bürger- oder Digitalcheck nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn sie frühzeitig in den Erarbeitungsprozess integriert und als methodische Prozessunterstützung in der frühen Konzeptionsphase verstanden werden. Die Assoziation des Digitalcheck mit einer Checkliste sorgt jedoch dafür, dass die Instrumente häufig erst am Ende berücksichtigt und als zusätzliche, bürokratische Last empfunden werden. So bleiben die eigentlichen Mehrwerte der unterschiedlichen Digitalcheck Maßnahmen aus. Dies bestätigen nicht nur die Evaluationsergebnisse. Auch Verwaltungsmitarbeiter:innen berichten, dass die über 40 verschiedenen Checks kaum noch zu überblicken sind und im dicht getakteten Arbeitsalltag selten konsequent angewendet werden.
Was es stattdessen braucht: Ein kohärentes Vorgehen in der frühen Konzeptionsphase, das die anvisierte Wirkung „der Checks“ (Digitaltauglichkeit, Praxistauglichkeit, Bürgerzentrierung etc.) gewährleistet – ohne zusätzliche Bürokratie zu schaffen.
Erfahrungen nutzen, Strukturen bündeln: Es braucht eine zentrale Serviceeinheit für Gesetzgebung
Unsere Erfahrungen und Wirkungsmessungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Maßnahmen effektiv sind. Visualisierungen wie Prozessabläufe und Entscheidungsbäume, der gezielte Einbezug von Umsetzungsakteuren und Betroffenen sowie die interdisziplinäre Unterstützung – insbesondere durch IT- und Service-Design-Expertise, die in der Verwaltung noch selten ist – helfen, Regelungen digital- und praxistauglich zu gestalten.
Aber: Es ist nicht ausreichend, bestehende Initiativen der besseren Rechtsetzung nur weiterzuentwickeln – auch die zugrunde liegenden Strukturen müssen sich verändern. Die neue Legislaturperiode bietet die Chance, die strukturellen Rahmenbedingungen für die Erarbeitung von Regelungsvorhaben gezielt zu verbessern. Nur dann kann die Gesetzgebung als Hebel für den Bürokratieabbau und die Digitalisierung der Verwaltung genutzt werden.
Um diese Maßnahmen flächendeckend zu verankern, sollte eine zentrale Serviceeinheit für die Gesetzgebung eingerichtet werden. Diese Einheit kann die Bundesministerien bei der Erarbeitung von Regelungsvorhaben unterstützen. Zudem entwickelt sie Instrumente und Hilfestellungen weiter, bündelt Schulungsangebote und bietet diese flächendeckend an. Länder wie die Niederlande und Großbritannien haben mit ähnlichen Ansätzen bereits positive Erfahrungen gemacht. Besonders bei Themen mit hoher politischer Priorität und in Krisensituationen könnten interdisziplinäre Teams kurzfristig Bundesministerien unterstützen und ihre Umsetzungskompetenz einbringen. So lassen sich Hindernisse schneller überwinden und eine moderne, effiziente Verwaltung aufbauen. Das machen unsere Erfahrungen und die Evaluierung deutlich.
Weitere Informationen zur Evaluierung und Methodik lassen sich auf GitHub abrufen.
Mehr zum Thema lesen